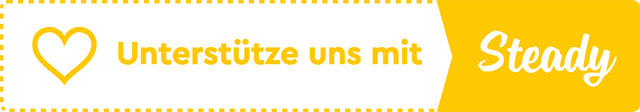Ein zerbrochenes Erinnerungsstück im Borusseum, ein Kapitän mit migrantischen Wurzeln und die Frage, was Heimat im Ruhrgebiet eigentlich bedeutet: Dieser Text folgt Emre Can dorthin, wo Fußball, Geschichte und Zugehörigkeit ineinandergreifen. Eine persönliche Annäherung an einen Spieler, der für Borussia Dortmund mehr verkörpert als Leistung – nämlich ein Stück Identität.
Im Borusseum liegt eine zerbrochene Brille – die von Jürgen Klopp. Unten auf der Plakette steht sinngemäß: „Jürgen Klopp ist ein Trainer, wie ihn das Ruhrgebiet liebt.“ Als ich diese Brille vor einigen Jahren zum ersten Mal sah, hat sich dieser Satz in mir festgesetzt. Weil er etwas benennt, das man nicht messen kann, aber sofort spürt: dass manche Menschen zu einem Ort gehören, bevor sie ihn betreten.
Seither frage ich mich, was es heißt, wenn ein Gegenstand – und erst recht ein Mensch – zu einem Verein gehört. Die Brille ist längst mehr als ein Relikt. Sie ist ein Stück BVB‑Anatomie, ein Speicher für Geschichten, die nicht in Pokalen, sondern in Dingen fortleben, die getragen, benutzt und zerbrochen wurden.
In den letzten Jahren habe ich viel über Heimat nachgedacht: im Schreiben, in meinem nicht enden-wollenden Studium, in Momenten, in denen Nostalgie einfach über mich hinwegrollte wie eine Welle. Und gerade jetzt, im November, diesem schweigsamen Monat des Gedenkens, legt sich eine weichere, tiefer atmende Sehnsucht über mich. Nicht schwer, eher wie eine Hand, die auf der Schulter ruht und sagt: Schau hin. Nichts bleibt. Und gerade deshalb zählt das, was ist.
Dortmund ist einer dieser Orte, zu denen mich meine Sehnsucht immer wieder zurückruft, leise und beharrlich. Hier kann ich die Vergangenheit eines Ortes sezieren und mich fragen, was Heimat eigentlich bedeutet. Und immer wieder gelange ich zur gleichen Erkenntnis: Heimat ist hier nicht museal gezeigter Besitz, sondern als etwas, das uns prägt, auch wenn wir von anderswo kommen oder lange weg waren.
Vielleicht hat mich deshalb die Brille so bewegt: weil sie zeigt, dass Zugehörigkeit weniger mit Geografie zu tun hat als mit dem, was in uns weiterklingt. Ein Verein kann so ein innerer Raum sein. Ein Gefühl. Oder ein Spieler.
Und so geht es mir mit Emre Can.
Ich mag ihn als Menschen auf eine Weise, die sich schwer erklären lässt, obwohl ich ihn persönlich gar nicht kenne. Vielleicht berührt mich gerade deshalb dieses Ungekünstelte, das er ausstrahlt, etwas, das sofort nah wirkt, ohne dass Nähe behauptet wird. Vielleicht, weil er wie jemand wirkt, der an jedem Ort der Welt das Herz zuerst auf den Tisch legt. Vielleicht, weil er sich nicht verstellt. Oder vielleicht weil er ein Fußballer ist, wie ihn das Ruhrgebiet seit Jahrzehnten liebt: ehrlich, geerdet, lustig. Nichts Glitzerndes, nichts Überhöhtes. Nur ein Mensch, der weiß, wo er herkommt. Und das nicht versteckt.
Manchmal denke ich, Emre Can verkörpert Borussia Dortmund so, wie es gerade niemand sonst tut. Zumindest für mich. Nicht, weil er der beste Spieler wäre. Nicht, weil er spektakuläre Rekorde bricht. Sondern weil er etwas mitbringt, das hier tief im lehmigen Boden steckt: ein Gespür für Gemeinschaft, für Arbeit, für Stolz ohne große Worte. Ein Frankfurter, der so sehr Ruhrgebiet ist, dass ich nicht anders kann, als zu glauben, er sei für diesen Verein, für diese Region und ihren doch so eigenen Menschenschlag gemacht.
Es steckt eine feine Ironie darin, die mich jedes Mal trifft, wenn ich darüber nachdenke, dass ausgerechnet Emre Can Kapitän ist. In einer Liga, in der migrantische Kapitäne selten sind. Dass einer wie er für einen Ort steht, der seit über hundert Jahren von migrantischen Menschen lebt.
Gerade hier, im Ruhrgebiet, trägt jede Geschichte einen Nachhall des Anwerbeabkommens von 1961 in sich, als die ersten türkischen Arbeiter in die Zechen und Stahlwerke kamen. Viele wollten nur für eine kurze Zeit bleiben – ein Jahr vielleicht, zwei –, doch sie blieben für Jahrzehnte, gründeten Familien, bauten Vereine, eröffneten Läden. Sie wurden Teil der Straßen, der Gerüche, der Stimmen. Ohne sie wäre das Revier nicht das, was es ist. Kein Kohleabbau ohne die Hände, die aus Anatolien kamen. Keine Schichtwechsel ohne die Sprachen, die sich im Morgengrauen mischten. Kein Fußball ohne die Kinder, die auf Ascheplätzen groß wurden, wo man in drei Sprachen fluchte und in einer jubelte.
Das Ruhrgebiet ist ein Mosaik aus Herkünften. Und Emre Can, Sohn einer Gastarbeiterfamilie, trägt die Binde eines Vereins, der so viele Geschichten in sich versammelt, dass eine zusätzliche gar nicht auffällt. Und doch ist sie wichtig. Denn in ihm schimmert etwas von dieser Geschichte: die Arbeit, die Migration, die Beharrlichkeit, der Wille, der Glaube daran, dass man sich seinen Platz verdienen muss – und verdienen darf.
Vielleicht macht ihn genau das zu einer Figur, welche die Ideale dieses Vereins so klar widerspiegelt. Ein Spieler, der weiß, wie es ist, sich seinen Platz zu erarbeiten, statt ihn geschenkt zu bekommen. Einer, dessen Präsenz eher an eine gelebte Haltung erinnert als an einen Mythos.
Ich weiß, dass viele über ihn diskutieren – über Form, über Körperlichkeit, über Entscheidungen. Und ja, ich verstehe all das; es ist Teil des Spiels. Aber es ist nicht das, worauf mein Blick zuerst fällt. Er verhakt sich in seinem ernsten Gesichtsausdruck, wenn er sich den Ball für den Elfmeter zurecht schiebt. Wenn er nach einem Fehlpass die sprichwörtlichen Ärmel hochkrempelt. Wenn er diesen kurzen, breiten Schritt macht, der aussieht, als würde er sagen: "Alles klar, ich erledige das."
Man kann viel über Führung reden, aber manchmal ist es einfach das Gefühl, dass jemand da ist, wenn’s brennt. Und genau deshalb ist dieser Text überhaupt möglich. Weil Emre Can wieder da ist. Weil jemand zurückkehrt, nicht als Held, sondern als einer von uns: mit all seiner Kraft, all seiner Normalität und all seiner Geschichte. Ein Spieler, der Dortmund nicht besser macht, weil er glänzt, sondern weil er sich reinwirft, sich entschuldigt, weitermacht.
Vielleicht steht er gerade deshalb so sehr für Borussia Dortmund: weil er nicht perfekt ist, weil er an manchen Tagen schwankt, weil er zweifelt, weil er wächst. So wie der Verein selbst seit Jahrzehnten schwankt: nicht aus Schwäche, sondern weil dieses Schwanken zu Dortmund gehört wie Staub zu den Zechen. Und weil er trotzdem führt.
Ein Typ, wie Borussia Dortmund ihn liebt.
Ein Typ, wie das Ruhrgebiet ihn versteht.
Und einer, der für mich immer ein bisschen mehr ist als der Spieler mit der Nummer 23. Ein Stück Identität, das sich nicht erklären muss.
Weitere Artikel